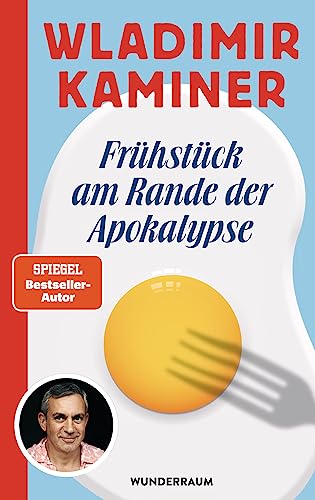Putin ist überhaupt nichts mehr heilig
Russlands Krieg gegen die Ukraine fordert unzählige Leben. Beim Werben um neue Soldaten hat Wladimir Putin eine Verbündete an seiner Seite: die Russisch-Orthodoxe Kirche. Wladimir Kaminer weiß mehr darüber.
Allein mit Geld ist kein Krieg zu gewinnen, schon gar nicht ein Stellungskrieg, der viele Menschenleben kostet. Der russische Staat hat sich dazu verpflichtet, für jeden gefallenen Soldaten eine "Prämie" in zweistelliger Millionenhöhe – in Rubel – an die betreffenden Familien zu zahlen. Bei Zigtausenden von Toten an der Front ist das ein ordentlicher Batzen.
Aber nicht nur die Staatskasse, auch die Wirtschaft wird durch einen solchen Krieg auf Dauer geschwächt. Schon heute ist mehr als die Hälfte der russischen Produktion für die friedlichen Bürger nicht mehr zu konsumieren, denn Bomben, Drohnen und Raketen kann man nicht essen. Und wenn Menschen hungern, haben sie Fragen an den Staat.

Wladimir Kaminer ist Schriftsteller und Kolumnist. Er wurde 1967 in Moskau geboren und lebt seit mehr als 30 Jahren in Deutschland. Zu seinen bekanntesten Werken gehört "Russendisko". Im August 2023 ist sein neues Buch "Frühstück am Rande der Apokalypse" erschienen.
Deswegen bemüht sich der russische Präsident, eine Ideologie zu erschaffen, die seine Bürger dazu bringt, nicht allzu anspruchsvoll zu sein – und am besten für umsonst das Leben an der Front zu riskieren. In diesem Vorhaben stützt er sich auf die Russisch-Orthodoxe Kirche. Die Propaganda erzählt Tag für Tag, dass es bei diesem Krieg überhaupt nicht um die Eroberung irgendwelcher kaputt geschossener Dörfer in der Ostukraine gehe, sondern um einen heiligen Krieg gegen den Westen, der die wahren christlichen Werte gegen LGBTQ und ein Goldenes Kalb ausgetauscht habe.
Nur die Russen, als letztes christianisiertes Volk der Erde, könnten die Welt vor dem Untergang retten, heißt es. Vor diesem Hintergrund erhält die Russisch-Orthodoxe Kirche, als Avantgarde der neuen Ideologie, enorme Summen vom Staat. Sie hat jetzt Zugang zu den Schulen, sie hält Unterricht an den Universitäten, sie ist ständig in den staatstreuen russischen Medien präsent.
Krieg gegen die Kirche
Ohne den Segen der Kirche startet keine Rakete vom Kosmodrom Baikonur; Regierungssitzungen, sogar die Pläne des Generalstabs, müssen vom Patriarchen Kyrill I. persönlich abgesegnet werden. Die Kirche lebt gut in dieser symbiotischen Beziehung mit dem totalitären Staat. Der Patriarch, genauso wie der Präsident, ist ein ehemaliger Agent des KGB: Während Putin in Dresden spionierte, war Kyrill I. einst in Genf für den sowjetischen Staat tätig.
Seine Bekannten aus dieser Zeit erinnern sich, dass der zukünftige Patriarch ein leidenschaftlicher Skifahrer und Weinbrandtrinker war. Die Tatsache, dass Kirchenobere wie Kyrill I. aus den Reihen des Geheimdienstes rekrutiert wurden, ist der Geschichte des Landes geschuldet. Gleich nach der Oktoberrevolution vor mehr als hundert Jahren haben die Bolschewiken der Kirche des zaristischen Russland den Krieg erklärt.
Gottesdiener wurden in Massen erschossen, die Gotteshäuser gesprengt oder in Lagerhallen umgewandelt. Jeder aus meiner Generation kennt ein solches Gebäude, ich bin auch neben einer ehemaligen Kirche aufgewachsen, die zu einem Depot für Kartoffeln umfunktioniert worden war. Doch dann nahm die Geschichte der Kirche eine unerwartete Wendung. Im Großen Vaterländischen Krieg von 1941 bis 1945, als das Land vor einer existenziellen Herausforderung stand, suchte Josef Stalin nach einer dringend notwendigen Stärkung des Patriotismus.
Nicht nur Marx und Engels, auch Gott soll auf unserer Seite sein, dachte er. Stalin schuf also schnell eine neue orthodoxe Kirche, ihre Führungskräfte wurden von der Staatssicherheit angeworben. Diese neue Kirche fand daraufhin erstaunlich schnell ihren Platz in einer mehrheitlich atheistischen Gesellschaft. Nach dem Krieg wurde das Projekt Kirche dann wieder eingemottet.
Alte Seilschaften
Erst unter Michail Gorbatschow erlebte sie ihre zweite Renaissance. Der politische Druck auf die Gesellschaft ließ nach, das Interesse an der Kirche stieg. Unter Gorbatschow hatte die Kirche viel Freiheit und bekam sogar einige ihrer Gotteshäuser zurück, die Kartoffeln mussten umgelagert werden. Zum Zeitpunkt des Unterganges der Sowjetunion war die Russisch-Orthodoxe Kirche eine gesellschaftliche Institution mit großer Autorität, 1990 äußerten laut Umfrage 67 Prozent der Bevölkerung, dass sie der Kirche vertrauen – und das nach 70 Jahren Atheismus.